Über das Projekt
Wie viele Patient:innen kommen täglich in die Notaufnahme? Wie dringend müssen sie behandelt werden und mit welchen Beschwerden haben sie die Notaufnahme aufgesucht? Leider sind diese Daten in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Mit der AKTIN-Plattform und dem Notaufnahmeregister, die aus einem gemeinsamen Forschungsprojekt der Universitätsmedizin Magdeburg und dem Institut für Medizinische Informatik der Uniklinik RWTH Aachen entstanden sind, können diese Informationen nun in den teilnehmenden Kliniken dezentral erfasst und verfügbar gemacht werden. AKTIN steht dabei für "Aktionsbündnis für Informations- und Kommunikationstechnologie in Intensiv- und Notfallmedizin“.
Das wichtigste im überblick
In AKTIN@NUM wird die AKTIN-Infrastruktur und das AKTIN-Notaufnahmeregister betrieben. Derzeit sind 56 universitäre und nicht-universitäre Einrichtungen aller Versorgungsstufen an die AKTIN-Infrastruktur angeschlossen; ab 2025 werden es über 70 sein. Die AKTIN-Infrastruktur bietet eine Plattform, die es ermöglicht, täglich standardisierte klinische Daten aus der Patientenversorgung automatisch zu erfassen – standortübergreifend und unabhängig von den primären elektronischen Dokumentationssystemen, unter Einhaltung der Datenschutzvorschriften. AKTIN umfasst dabei auch die Entwicklung und Pflege von Dokumentations- und Interoperabilitätsstandards im Bereich der Intensiv- und Notfallmedizin sowie eine technische und organisatorische Plattform auf Basis dieser Standards. Ziel ist es, diese Daten für (Versorgungs-)Forschung, Qualitätssicherung und Gesundheitsberichterstattung (Surveillance) nutzbar zu machen. Auf der Plattform betreibt das AKTIN-Team das AKTIN-Notaufnahmeregister als eine Anwendung. Das Notaufnahmeregister ermöglicht den Zugang zu Daten aus Notaufnahmen für die o.g. Zwecke.
Bis zur Entwicklung und Verbreitung der AKTIN-Infrastruktur mussten Datenerhebungen zum Gesundheitszustand der Bevölkerung allgemein oder im Rahmen von z.B. Infektionsausbrüchen kurzfristig implementiert und die Daten oft manuell erhoben werden, nachdem die Krankenhäuser diese an die örtlichen Gesundheitsbehörden gemeldet hatten. Alternativ wurden die Daten in monozentrischen Studien erhoben. Dies führte zu einem erheblichen Mehraufwand für das medizinische Personal und ggf. zu Verzögerungen in der Verfügbarkeit der Daten.
In der AKTIN-Infrastruktur werden Daten aus den jeweiligen Dokumentationssystemen über eine standardisierte Schnittstelle (HL7 CDA) kontinuierlich an ein lokales Data-Warehouse (DWH) übertragen. Im DWH gespeichert, stehen die Daten für die verschiedenen Anwendungen zur Verfügung und bleiben dabei primär im Verantwortungsbereich und unter der Kontrolle der jeweiligen Einrichtung. Anfragen zu spezifischen Forschungsfragen werden den DWHs über einen Broker zur Verfügung gestellt. Gibt die Einrichtung ihre Daten für eine spezifische Anfrage frei, werden diese in einem Aggregator gesammelt erfasst und im Trusted Research Environment aufgearbeitet.
Für das AKTIN-Notaufnahmeregister werden die Daten gemäß Datensatz Notaufnahme der DIVI e.V. und die Daten gemäß §21 KHEntgG erfasst und bereitgestellt. Über die Zulassung einer Forschungsfrage auf dem Registerdatensatz entscheidet das Data Use and Access Committee des Notaufnahmeregisters, die Datenauswertung erfolgt im Trusted Data Analytics Center (TDAC).
In der ersten Förderphase des NUM wurden im Projekt AKTIN-EZV 29 weitere Notaufnahmen an die Infrastruktur angeschlossen und nehmen seither am Register teil. Mit der kontinuierlichen Datenerfassung in den Notaufnahmen ist es möglich, das Geschehen in der klinischen Notfallversorgung in Deutschland tagesaktuell zu überwachen. Mit der Erhebung von täglichen Routinedaten wird Neuland an der Schnittstelle zwischen Patientenversorgung und Public-Health-Surveillance betreten. AKTIN leistet damit einen Beitrag zur Erkennung der Entwicklung in der aktuellen Pandemie oder zukünftiger Epidemien und Gefahrenlagen.
Die über dieses Projekt realisierte bundesweite Datenerhebung ermöglicht einen räumlich differenzierten Überblick über Patientenzahlen und Versorgungsdetails in Notaufnahmen. Durch die Analyse der auftretenden Symptome und Diagnosen wird zusätzlich der Einfluss verschiedener Erkrankungen auf die Patientenversorgung untersucht. Die über AKTIN erhobenen Daten aus den teilnehmenden Notaufnahmen werden in den „Dashboards der Notaufnahmesurveillance“ des RKI regelmäßig veröffentlicht und fließen einmal wöchentlich in den Infektionsradar des BMG ein.
RKI Dashboard der Notaufnahmesurveillance
Infektionsradar des Bundesministeriums für Gesundheit
Aktin@NUM Teilprojekte
Ziel des auf der Infrastruktur AKTIN@NUM basierenden Forschungsprojektes AKTIN2.0 ist der weitere Ausbau des AKTIN-Notaufnahmeregisters zu einer flächendeckenden Infrastruktur für eine „Echtzeit-Versorgungsforschung“ in Notaufnahmen.
Die Infrastruktur des AKTIN-Notaufnahmeregisters ermöglicht den forschungszweckgebundenen Zugriff auf Routinedaten der Notaufnahmeversorgung. Das Konzept des Registers fußt auf Interoperabilitätsstandards unter der Nutzung von Arztbriefen im HL7 CDA Format. Die flächendeckende Etablierung von Interoperabilitätsstandards ermöglicht die interne Nutzung zu Zwecken außerhalb des AKTIN Notaufnahmeregisters. Diese können somit bspw. von den Datenintegrationszentren der Medizininformatik-Initiative (MII) genutzt werden - so wird die Kompatibilität zu Projekten der MII ermöglicht.
Der Anspruch des Forschungsprojektes besteht in einer bundesweiten Abdeckung der Datenerhebung aus Notaufnahmen, die sich nur durch Kooperation einer großen Zahl beteiligter Partner realisieren lässt. Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Netzwerk die in diesem Projekt priorisierten Universitätsklinika. Diese spielen grundsätzlich eine zentrale Rolle für die medizinische Versorgung und sind darüber hinaus wegen ihrer Steuerungs- und Kommunikationsfunktion in der Pandemie, auch für entfernt liegende Hotspots von Bedeutung. Die große Datenbasis und die umfassende überregionale Abdeckung sind die Voraussetzungen für beispielsweise eine bundesweite Surveillance. Zudem ermöglicht die Standardisierung die Übermittlung der Basisdaten der Akutversorgung aus dem AKTIN-Notaufnahmeregister in andere Register. Des Weiteren ermöglicht die Vernetzung mit dem Projekt PREPARED einen Ausbau und die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Surveillance von Infektionserkrankungen. Es werden Infrastrukturen, Inhalte und die Kommunikationskanäle abgestimmt, sodass eine synergistische Nutzung ermöglicht werden kann.
Ziel des bereits abgeschlossenen Projekts war der Ausbau des AKTIN-Notaufnahmeregisters auf 50 Notaufnahmen, sowohl universitär als auch nicht-universitär, zu einer flächendeckenden Infrastruktur für Echtzeit-Versorgungsforschung in Notaufnahmen.
Analysen von Routinedaten aus der COVID-19-Pandemietrugen dazu bei, Erkenntnisse über die Inanspruchnahme zentraler Notaufnahmen zu erhalten. Zudem wurden tagesaktuelle Daten aus den Notaufnahmen für epidemiologische Auswertungen automatisiert bereitgestellt und COVID-19-spezifische Forschungsfragen in diesem Zuge bearbeitet.
Um die Aussagekraft der Daten weiter zu verbessern, konnte im Rahmen des Projektes „AKTIN-EZV“ durch die Anbindung weiterer 17 Universitätskliniken und sechs nicht-universitärer Kliniken der bundesweiten Abdeckung nähergekommen werden. Die tägliche Datenlieferung an das RKI und die Nutzung der Daten wurden im Zuge des Projektes weiterentwickelt. In dem Projekt wurden zudem drei COVID-spezifische Forschungsfragen als Use-Cases bearbeitet.
Durch eine tagesaktuelle flächendeckende Datenerhebung in Notaufnahmen wurde erstmals eine kontinuierliche Beobachtung der Geschehnisse in der klinischen Notfallversorgung in Deutschland ermöglicht. Bislang waren im Kontext von Infektionsgeschehen Daten des Gesundheitszustandes der Bevölkerung erst nach mehreren Tagen bis Wochen nach Meldung der Kliniken an die lokalen Gesundheitsämter zu erheben. Durch sog. Signale in der Surveillance konnten Auffälligkeiten festgestellt werden. Damit konnte ein wertvoller Beitrag zur Erkennung der Entwicklung der COVID-19-Pandemie geleistet werden.
Mit der AKTIN Infrastruktur wurde die technische Basis für ein unabhängiges System etabliert, welches auch andere Gesundheitsphänomene feststellen und beschreiben kann. So können in zukünftigen Pandemien oder überregionalen Gesundheitsereignissen diese Mechanismen auch für die Beobachtung von Erkrankungen verwendet werden, die ein anderes Symptomspektrum als COVID-19 zeigen, z. B. Erkrankungen der Leber, der Niere, das Verdauungssystem oder das Nervensystem betreffend und nicht primär die Atemorgane.
Aktuelles
Highlights
Die bereits erlangte Datenbasis lässt bundesweite Auswertungen von Notaufnahmevorstellungen zu, die bisher nicht möglich waren. In folgenden Formaten werden die Registerdaten kontinuierlich veröffentlicht:

Daten des AKTIN-Notaufnahmeregister zur durchschnittlichen Verweildauer in teilnehmenden Notaufnahmen werden im Infektionsradar des BMG veröffentlicht, der zuvor Corona-Pandemieradar hieß. Aus der Aufenthaltsdauer der Patient:innen in den Notaufnahmen kann die Belastung der Notaufnahmen abgeleitet werden. Diese Analysen werden im BMG-Infektionsradar zur Darstellung der Belastung des Gesundheitswesens genutzt: je mehr Patient:innen, höhere Anzahlen schwerer Fälle, sinkende Personalressourcen oder fehlende Klinikbetten, desto größer wird die Aufenthaltsdauer in den Notaufnahmen.

Das Dashboard der Notaufnahmesurveillance des RKI stellt die Gesamtfallzahlen in den Notaufnahmen, sowie die Fallzahlen bestimmter Syndrome ausgelöst durch Infektionserkrankungen dar. Die Anzahl der Patient:innen, die sich mit infektiösen Atemwegserkrankungen in den Notaufnahmen vorstellt, bildet sehr gut das Krankheitsgeschehen und die Krankheitsschwere der jeweiligen Infektionswelle (z.B. Covid und Influenza) ab.

Zur politischen Entscheidungsfindung tragen Daten aus dem AKTIN-Notaufnahmeregister ebenfalls bei: Die Regierungskommission für eine bedarfsgerechte Krankenhausplanung hat Registerdaten zur Altersentwicklung der Patienten in den Notaufnahmen genutzt und in der 4. Stellungnahme im Januar 2023 veröffentlicht:
In der 9. Stellungnahme im August 2023 empfiehlt die Regierungskommission AKTIN als Anknüpfungspunkt für ein übergreifendes Notfallregister:
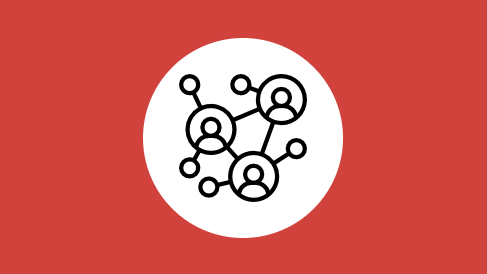
Das AKTIN-Notaufnahmeregister ist eng mit dem Robert Koch-Institut und den Standorten der Medizinischen Informatik Initiative verknüpft, was einen kontinuierlichen Austausch und die Nutzung von Synergien, wo immer möglich, erleichtert und zu zusätzlichen Forschungsprojekten führt.
Die AKTIN Registerinfrastruktur wurde und wird in mehreren Drittmittelprojekten genutzt: ENQuIRE (GBA 01VSF17005), OPTINOFA (GBA 01NVF17035), ILEG (GBA 01VSF19017), ENSURE (BMG ZMVI1-2520DAT803), Connect_ED (BMBF 16SV8979), EDCareKids (GBA 01VSF23042), KlimaNot (GBA 01VSF23017)

Im Rahmen der Medical Informatics Europe Konferenz wurden eine Pro and Con Session mit dem Titel „Federated and distributed medical research – Fortune or misfortune?“ sowie ein Workshop mit dem Titel „Caring before sharing – Validating EHR Data in Federated and Distributed Research Infrastructure An international Workshop“. Beide Veranstaltungen wurden in enger Kooperation mit Norwegian Primary Care Research Network „PraksisNett“ durchgeführt.
Auf den TMF Registertagen am 08. und 09. Mai 2023 wurde das AKTIN-Notaufnahmeregister als 3. Preisträger mit dem Innovationspreis Medizinische Register der init AG ausgezeichnet




