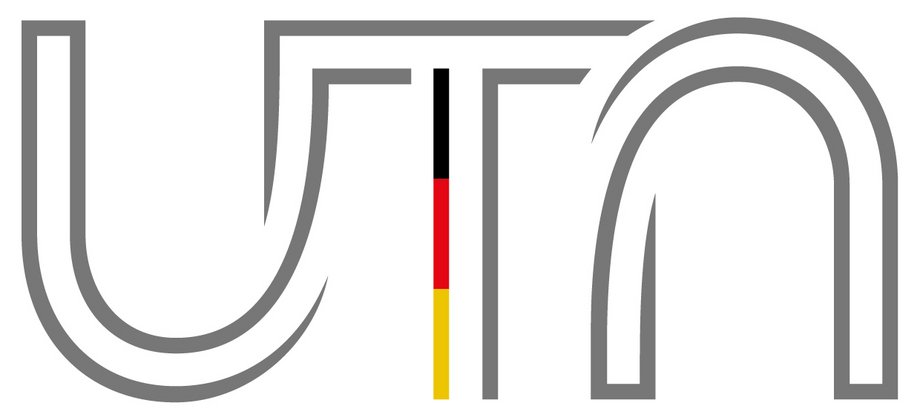Über das Projekt
Ziel des Projektes ist es, die Heterogenität der aktuellen telemedizinischen Infrastruktur der deutschen Universitätskliniken zu überwinden und eine standardisierte, telemedizinische Erfassung von Forschungsdaten zu COVID-19, mit Fokus auf semantischer und syntaktischer Interoperabilität zu schaffen. Darüber hinaus soll eine evidenzbasierte Leitlinie für die telemedizinische Versorgung entwickelt werden.
Das Wichtigste im Überblick
Das Hauptziel des UTN-Projekts ist es, Grundlagen für eine nationale standardisierte elektronische Datenerfassung mittels Telemedizin für die universitäre Forschung zu legen und infrastrukturell dauerhaft zu unterstützen. Dabei sollen Standards für bestehende telemedizinische Strukturen der deutschen Universitätskliniken formuliert werden. Ziel der Projektbeteiligen ist es, die bereits bestehenden heterogenen telemedizinischen Strukturen an deutschen Universitätskliniken zu vereinheitlichen und eine einfache und kostengünstige Nutzung an allen Universitätskliniken zu ermöglichen. Durch einen gemeinsamen Standard und regelmäßige Updates will UTN einen breiten telemedizinischen Studien-Support für Kliniker und Wissenschaftler erreichen.
Die Herausforderungen des UTN-Projekts liegen vor allem in der Standardisierung und Vereinheitlichung der bestehenden heterogenen telemedizinischen Strukturen an deutschen Universitätskliniken. Die Entwicklung und Implementierung eines nationalen Standards für die elektronische Datenerfassung mittels Telemedizin erfordert eine präzise Formulierung von Standards, die den vielfältigen Anforderungen und Gegebenheiten der einzelnen Kliniken gerecht werden. Dabei müssen nicht nur technologische Aspekte, sondern auch rechtliche und organisatorische Herausforderungen berücksichtigt werden.
Im Rahmen der Umsetzung und Einrichtung des UTN-Projekts wird der erste Schritt darin bestehen, einen Rahmen für die standardisierte elektronische Datenerfassung und -integration im Kontext der COVID-19 Forschung zu schaffen. Vor dem Hintergrund bereits vorhandener telemedizinischer Dateninfrastrukturen und -netze an Universitätskliniken wird UTN auf diesen bestehenden Systemen aufbauen und sie in die neue Struktur integrieren. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der semantischen und syntaktischen Interoperabilität sowie auf der reibungslosen Integration in die bestehenden NUM- und MII-Infrastrukturen. Die NUM-Standorte werden dabei als zentrale Knotenpunkte agieren, und UTN wird als organisatorische Infrastruktur fungieren. Diese Struktur ermöglicht eine gezielte, standortübergreifende Konsolidierung von hochfrequenten, telemedizinisch generierten Forschungsdaten unter optimaler Nutzung bereits existierender oder im Entstehen begriffener NUM-Infrastrukturen.
Um die Effektivität der Telemedizin als Unterstützung für die Längsschnittdatenerfassung, insbesondere im Rahmen von Kohortenstudien, zu untersuchen, wird die neu geschaffene Struktur anhand eines geeigneten Use Cases überprüft. Dieser Use Case wird telemedizinische Daten erfassen, um die praktische Anwendbarkeit und Wirksamkeit dieser neu gebildeten Struktur zu evaluieren.